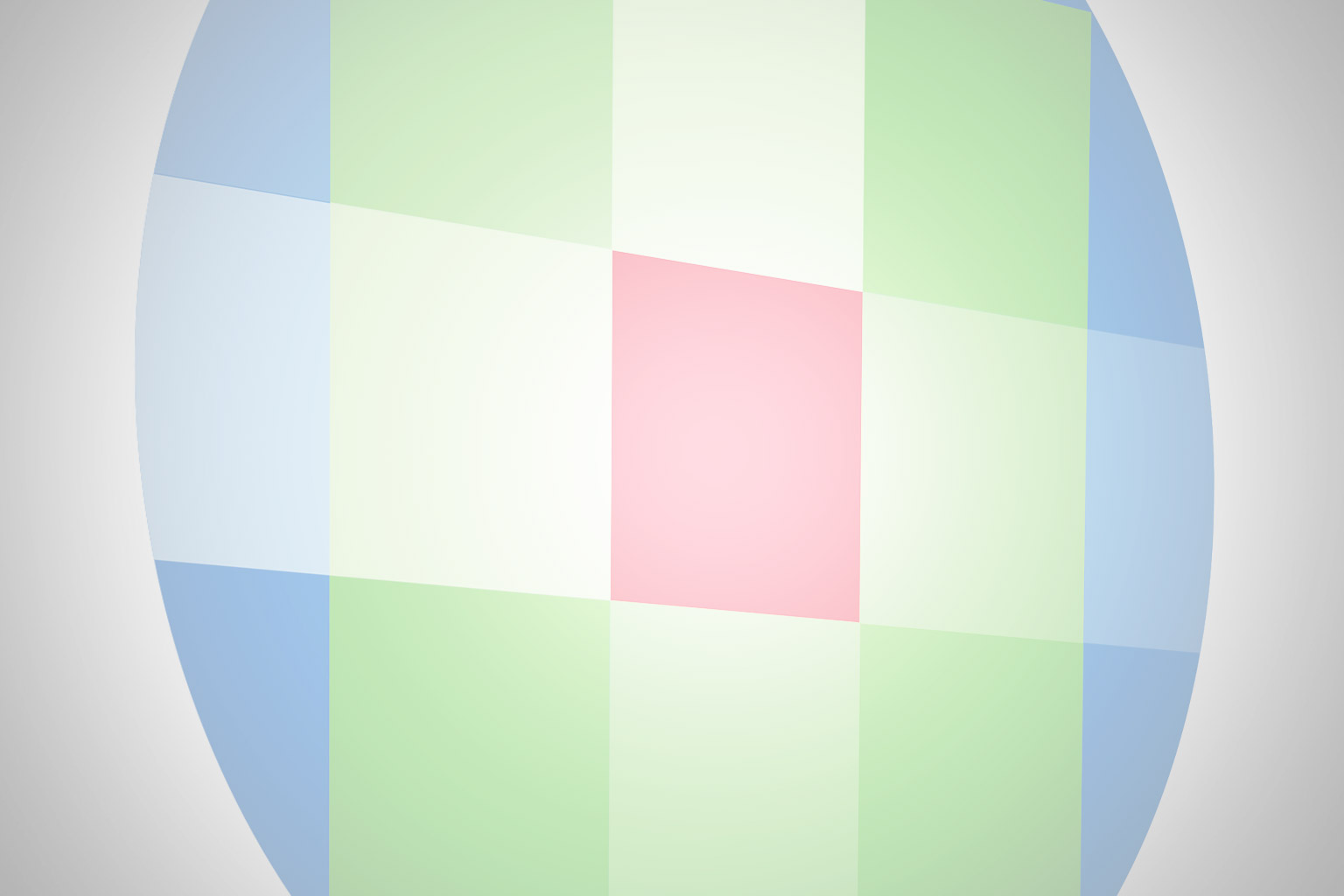Eine ungekürzte Version des Beitrages finden Sie in Heft 6 der Zeitschrift ZFSH/SGB, die Sie hier abonnieren können.
Alexander Lahne
I. Einführung
Unlängst beantwortete ein sehr kluger Mann, der uns am Ende dieses Beitrags noch einmal begegnen wird, die Frage, was das Geheimnis seiner Gelassenheit sei, damit, dass er „maximale Distanz zu Marotten“ anderer einhielte. Der Duden versteht unter einer Marotte eine „seltsame, schrullige Eigenart“, eine „Angewohnheit“. Ich finde es selbst etwas wunderlich, dass mir hierzu als erstes eine Sache einfällt, die ich seit längerem im Auge habe: Die Tendenz der Sozialgesetzgebung, unklare Begriffe und unpraktikable Floskeln zu verwenden und Regelungen zu schaffen, die zum Teil an der Realität knallhart vorbeigehen.
Beispiele zu den Unklarheiten fallen mir auf Anhieb gleich mehrere ein1 und Fakt ist: Die einzigen, die wirklich Auskunft darüber geben können, welche Sachverhalte sich in Jobcentern abspielen, was dort die Realität ist, sind diejenigen, die dort arbeiten. Maximale Distanz zur oben erwähnten Marotte des Gesetzgebers zu halten, ist in den Jobcentern aber eben gerade nicht möglich, das ganze Gegenteil ist der Fall: Es gilt vielmehr, durch diese Marotte aufkommende Fragen rasch, praktikabel und rechtssicher zu beantworten.
Fragen wirft beispielsweise die (nicht mehr ganz) neue Gestaltung der Regelungen zur Ortsabwesenheit von Personen, die im Bürgergeldbezug stehen, auf. Hierzu gilt seit dem 01.07.2023 die Vorschrift des § 7b SGB II, welche durch die zum 08.08.2023 in Kraft getretene Erreichbarkeitsverordnung (ErrV) ergänzt wird. Das Gute vorweg: Hinter diesen zunächst unaufgeräumt wirkenden Vorschriften findet man, wenn man sich die Mühe macht, ein recht klares System aus Fallgruppen und Zeiträumen, das zugrunde gelegt werden kann2. Aber eben: Schwammige Begriffe und Uneindeutigkeiten bei Praxisbezügen zu immer komplizierter werdenden Sachverhalten machen den Mitarbeitenden in den Jobcentern die Sache schwerer, als sie sein müsste.
Die Einführung des § 7b SGB II und der Erreichbarkeitsverordnung geben Anlass, sich einer in ihren Grundzügen alten Thematik aus einem neuen Blickwinkel zu nähern und konkrete Fragen zu sammeln, welche nach zeitgemäßen und -gerechten Antworten suchen. Drei davon werden hier näher beleuchtet, wobei den Ausführungen meine persönlichen Rechtsauffassungen zugrunde liegen.
II. Exemplarische Fallgestaltungen
1. Ortsabwesenheit wegen ärztlich verordneter Maßnahmen (§ 7b Abs. 2 S. 2 Nr. 1 SGB II)
Als wichtiger Grund für eine Ortsabwesenheit kommt (für die gesamte Behandlungsdauer inkl. der Tage der An- und Abreise3) eine „ärztlich verordnete Maßnahme“ in Betracht. Diese Fallgruppe begreifen wir vor dem Hintergrund der inzwischen in die Jahre gekommenen Erreichbarkeitsanordnung (EAO) nicht als Neuerung4, jedoch ist wegen einer Vielzahl von reger Mobilität (oft über mehrere Landesgrenzen hinweg) geprägten Fallbeispielen eine Auffrischung der Thematik gefragt.
Immer wieder stellt sich für die Integrationsfachkräfte die Frage, in welchen Ländern derartige Heilbehandlungen durchgeführt werden müssen, damit hierfür Ortsabwesenheiten genehmigt werden können, ohne dass auf den allgemeinen Auffangtatbestand („insgesamt drei Wochen Urlaub im Jahr“) des § 7b Abs. 3 S. 2 SGB II zurückgegriffen werden muss. „Gibt es einen Länderkatalog?“ - so die konkrete Frage, die mir gestellt wurde. Und tatsächlich: Es gibt ihn.
Es gilt, innerhalb der Regelungen des deutschen Sozialsystems, also im Rahmen der Sozialgesetzbücher, nach hilfreichen Ansätzen zu suchen. Diese findet man zur aufgeworfenen Problematik im SGB V, dem Buch der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Vorschrift des § 13 regelt dort recht verklausuliert in ihren Absätzen 4 bis 6, dass deutsche Krankenkassen grundsätzlich (aber nur bis zur Höhe der Kosten einer gleichwertigen Behandlung im Inland) Kosten einer Behandlung zu übernehmen haben, die in EU-Ländern, in Island, in Liechtenstein, in Mazedonien, in Norwegen, in Serbien oder in der Schweiz erfolgen. Unterschieden wird hier nochmals zwischen ambulanten und stationären Behandlungen, was das Erfordernis einer vorherigen Genehmigung der Krankenkasse angeht; interessant für die Frage einer zu genehmigenden Ortsabwesenheit ist aber dieser Länderkatalog an sich.
Zwar gibt es Ausnahmevorschriften, nach denen eine deutsche Krankenkasse auch die Kosten einer Behandlung außerhalb dieses Geltungsbereiches zu übernehmen hätte: Dies betrifft jedoch zum Beispiel Fälle, in denen nachgewiesen werden kann, dass eine erfolgversprechende Behandlung ausschließlich dort zu erwarten ist (eine vergleichbare Therapie in Deutschland also nicht angeboten wird) oder eine Behandlung im Inland möglich wäre, jedoch wegen mangelnder Kapazitäten nicht mit der erforderlichen zeitlichen Nähe vorgenommen werden kann5.
Da es in der Praxis der Jobcenter griffige, aber schon wegen Art. 20 Abs. 3 GG rechtlich sauber herleitbare Lösungen braucht, ist der oben dargestellte Länderkatalog schon deswegen zu empfehlen, weil grundsätzlich eine Ortsabwesenheit wegen ärztlicher Behandlungen in genau den Ländern genehmigt werden kann, deren Kosten durch das Bürgergeld selbst - genauer: durch die Beiträge zur deutschen Krankenkasse - abgesichert werden.
Man bleibt somit innerhalb des Gefüges der Sozialgesetzbücher, kann auf den Gedanken der Einheitlichkeit der Rechtsordnung verweisen und somit neutrale und schlüssige Entscheidungen treffen. Bis hierher ist das gut machbar. Von den Integrationsfachkräften in den Jobcentern darüber hinaus Kenntnisse des SGB V zu verlangen, hieße hingegen, den Bogen zu überspannen.
2. Ortsabwesenheit wegen Veranstaltungen, die kirchlichen Zwecken dienen (§ 7b Abs. 2 S. 2 Nr. 2 Alt. 1 SGB II)
Eine Ortsabwesenheit ist für eine Dauer von bis zu drei Wochen im Jahr zu genehmigen, wenn eine Teilnahme an einer Veranstaltung, die kirchlichen oder gewerkschaftlichen Zwecken dient oder im öffentlichen Interesse liegt6, beabsichtigt ist7. Die erste Frage, die hier regelmäßig auftaucht: Warum „kirchlich“? Warum nicht „religiös“? Tatsächlich schafft es diese Fallgruppe ganz nach oben auf die Hitliste der explosivsten Diskussionen.
Der Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Erreichbarkeitsverordnung vom 14.07.2023 holt weiter aus und setzt auf Seite 13 den „Kirchen“ die sonstigen öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften gleich und gebraucht damit einen Begriff, der ebenfalls zu einem Katalog von Beispielen führt8: Neben christlichen Religionsgemeinschaften wird dort auf die Bahai-Gemeinde als nicht-christlich-jüdische Gemeinschaft und auf die Ahmadiyya Muslim Jamaat als muslimische öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft und auch auf die Alevitische Gemeinde verwiesen. Eine allumfassende Gleichsetzung der Religionen fehlt also, wenn man sich von einer wörtlichen Auslegung des Begriffes der „öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft“ her der Thematik nähert; gleichwohl wird diese allumfassende Gleichsetzung im Schrifttum vertreten9.
Ich wäre in Anlehnung der Ausführungen im Referentenentwurf für eine Anwendung des eben erwähnten Kataloges.
Bevor man hier jedoch weiter eintaucht, könnte man sich erst einmal dem Begriff der „Veranstaltung“ zuwenden, weil bereits ohne eine solche kein Grund für die Genehmigung einer Ortsabwesenheit gegeben ist, unabhängig von religiösen Fragen. Was aber ist eine „Veranstaltung“ in diesem Sinne? Fällt eine Wallfahrt, eine Totenwache oder ein mehrtägiger Hungerstreik, in behauptetem öffentlichem Interesse10 zugebracht auf einem Baum11 , unter diesen Begriff? Und wenn nein, warum nicht?
Wieder einmal heißt es, die Bedeutung eines Wortes klar zu umgrenzen, was in Zeiten einer immer undeutlicher werdenden Sprache, die oft Grund für Missverständnisse ist, zu begrüßen ist.
Nach dem Urteil des OLG Düsseldorf vom 01.07.2014 (I-20 U 131/13) wird der Begriff der „Veranstaltung“ wie folgt definiert: „…ein zeitlich begrenztes und geplantes Ereignis mit einer definierten Zielsetzung oder Absicht, einer Programmfolge mit thematischer, inhaltlicher Bindung oder Zweckbestimmung in der abgegrenzten Verantwortung eines Veranstalters, einer Person, Organisation oder Institution, an dem eine Gruppe von Menschen teilnimmt“.
Diese sperrige Definition wird die Integrationsfachkräfte, die vor Ort zu entscheiden haben, nicht zufriedenstellen. An dieser Stelle schaue ich wieder einmal12 zu unseren Nachbarn nach Österreich, welche sich offenbar klarer ausdrücken können. So fordert man dort für eine „Veranstaltung“ neben einem Veranstalter auch ein Publikum und Akteure13 . Letztendlich wird man aber, da uns in Deutschland die österreichischen Definitionen nicht weiterhelfen14 , in der Definition des OLG Düsseldorf weiter nach einem Anhaltspunkt suchen müssen, den man auch hier im Begriff des Veranstalters, aber auch in dem der Zielsetzung bzw. Absicht findet.
Aktionen, welche man grundsätzlich zeitlich nach eigenen Vorstellungen planen kann, werden regelmäßig keinen Veranstalter haben. Wallfahrten dürften also im Kern schon deshalb keine „Veranstaltungen“ darstellen, weil die Zielsetzung oder Absicht nicht der Antritt einer (organisierten) Reise ist, sondern diese nur den notwendigen Rahmen darstellt. Ebenso wenig wird darum eine Totenwache oder ein Hungerstreik eine Veranstaltung sein.
Interessant und hilfreich wäre es, zu erfahren, wie sich die Rechtsprechung hierzu konkretisierend äußern würde.
3. Ortsabwesenheit wegen der Pflegebedürftigkeit Angehöriger (§ 3 S. 1 Nr. 2 ErrV)
Ein weiterer Stolperstein findet sich in § 3 S. 1 Nr. 2 ErrV: Dort ist die Unterstützung Angehöriger wegen „Pflegebedürftigkeit“ als ein Beispielfall für eine zu genehmigende Ortsabwesenheit genannt15 . Hinsichtlich des Angehörigenbegriffs wird auf den - recht umfangreichen - Katalog des § 16 Abs. 5 SGB X verwiesen.
Es wird vertreten, dass der Begriff der Pflegebedürftigkeit in sachlichem Zusammenhang mit § 10 Nr. 4 SGB II stehe und im gleichen Sinne auszulegen sei16 . Ein festgestellter Pflegegrad soll also gerade keine Voraussetzung für die grundsätzliche Anwendbarkeit der Norm sein17 . Für diese Auffassung sprechen die Gedanken, welche Grundlage für die Umsetzung des „Sanktionenurteils“ des Bundesverfassungsgerichtes18 waren: So findet sich in § 31a Abs. 3 SGB II nun die Härtefallregelung, welche nach den Ausführungen der Bundesagentur für Arbeit in deren Fachlichen Weisungen19 auch dann greifen soll, wenn eine „umfangreiche Unterstützung eines nahen Familienangehörigen ohne Pflegestufe2021 “ zu einem „Unterdruckgeraten“ der erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person bei Erfüllung der Mitwirkungspflichten zu erwarten wäre. Somit ist das Vorliegen eines festgestellten Pflegegrades bei einer angehörigen Person nicht mehr zwingende Voraussetzung im Gefüge der Entschuldigungsgründe bei der Verletzung von Mitwirkungspflichten.
Die Fallgruppe des § 3 S. 1 Nr. 2 ErrV erfährt insofern ein einschränkendes Korrektiv, als dass es hier weitere Voraussetzung für eine Zustimmung zur Ortsabwesenheit ist, dass durch die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person nachgewiesen22 wird, dass die Unterstützung „erforderlich“ ist, also niemand sonst vor Ort zur Verfügung steht, um diese zu leisten. Es gibt in der Erreichbarkeitsverordnung keine Regelung dazu, wer zuständig für eine solche Bestätigung sein soll; dies könnte dann also ein Arzt, eine Pflegestelle oder auch die Nachbarin sein.
Darüber hinaus darf die Eingliederung in Arbeit oder Ausbildung auch hier nicht beeinträchtigt sein (vgl. § 3 S. 2 a. E. ErrV), was bedeutet, dass „insbesondere“ kein konkretes Ausbildungs- oder Arbeitsangebot vorliegen darf, das nach Ablauf des auswärtigen Aufenthaltes nicht mehr angenommen werden kann (so der Gedanke des § 7 Abs. 1 S. 2 ErrV).
In der Praxis wird eine sachgerechte Anwendung der entsprechenden Regelung also so aussehen, dass man diese auch in Bezug auf Angehörige ohne Pflegegrad gelten lässt, jedoch einen aussagekräftigen Nachweis der Erforderlichkeit einer Pflegeleistung fordern darf und darüber hinaus feststellt, dass ein konkretes Ausbildungs- oder Arbeitsangebot nicht vorliegt.
III. Fazit
Von dem eingangs erwähnten sehr klugen Mann - es handelt sich um den Schweizer Philosophen Martin Kunz - stammt ein weiterer Satz:
„Enttäuscht haben mich jene Intellektuellen, die vorschnell wissen, wie alles ist, es besser wissen als die Experten, die in der Regel bescheiden sind.“23
Verblüffend ist, wie sehr diese Worte zum Spannungsverhältnis passen, das oft entsteht, wenn die „Experten“, nämlich die Integrationsfachkräfte in den Jobcentern, griffige und praktikable Regelungen dringend brauchen, aber stattdessen Schwammiges und Undurchdachtes geliefert wird.
Fußnoten
1 Die „Fortschreibung“ (einst: einer Eingliederungsvereinbarung, nun: eines Kooperationsplanes) dürfte eines der gängigsten Beispiele sein; eine gesetzliche Definition findet sich im Sozialrecht hierfür bis heute nicht. Auch die „persönliche Anhörung“, welche durch § 31a Abs. 2 SGB II für den Bereich der „Leistungsminderungen“ zum 01.01.2023 neu eingeführt wurde, wirft in der Praxis immer wieder Fragen auf.
2 Dies tröstet ein wenig über die Tatsache hinweg, dass die Regelungen zur Ortsabwesenheit (in den Büros der Jobcenter kurz „OAW“ genannt) der aus § 14 SGB II folgenden Beratungspflicht unterfallen.
3 Vgl. § 5 Abs. 1 ErrV.
4 Vgl. § 3 Abs. 2 Nr. 1 EAO.
5 Vgl. „Auslandsbehandlung“, Punkt 3, abrufbar unter www.betanet.de.
6 Vgl. § 7b Abs. 2 S. 2 Nr. 2 ErrV.
7 Der Zweck der Veranstaltung und die tatsächliche Teilnahme sind nachzuweisen, vgl. § 5 Abs. 2 S. 2 ErrV.
8 Vgl. „öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft“ unter www.wikipedia.de.
9 Vgl. Leopold, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB II, 5. Aufl., § 7b Rdn. 51: „Veranstaltungen einer jeden Kirche …, ohne dass es deren staatlicher Anerkennung bedürfte“.
10 Wird den „kirchlichen Zwecken“ gleichgestellt, vgl. § 7b Abs. 2 S. 2 Nr. 2 SGB II.
11 Fallbeispiele aus der Praxis der Jobcenter.
12 Vgl. Lahne, Eine Auseinandersetzung mit den neuen Regelungen zu den Leistungsminderungen durch die Jobcenter bei beharrlicher Arbeitsverweigerung, abrufbar bei www.wolterskluwer.com.
13 Vgl. Vögl (Hrsg.), Praxishandbuch Veranstaltungsrecht, LexisNexis, S 1 f.
14 Eine rechtsvergleichende Auslegung des Veranstaltungsbegriffes dürfte allerdings zu weit gehen.
15 Für eine Dauer bis zu 12 Wochen im Kalenderjahr, vgl. § 5 Abs. 5 S. 2 ErrV.
16 Vgl. Leopold, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB II, 5. Aufl., § 7b Rdn. 54 mit Verweis auf den RefE der ErrV.
17 Vgl. Böttiger, in: Luik/Harich, SGB II, 6. Aufl. 2024, § 10 Rdn. 64.
18 BVerfG, Urt. v. 05.11.2019 - 1 BvL 7/16.
19 Fachliche Weisungen der Bundesagentur für Arbeit zu §§ 31ff. SGB II, Stand: 28.03.2024, Rz. 31.41.
20 Gemeint ist wohl „Pflegegrad“, so der ab dem 01.01.2017 maßgebliche Begriff.
21 Herv. durch den Verfasser.
22 Vgl. § 3 S. 3 ErrV, vgl. auch Leopold, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB II, 5. Aufl., § 7b Rdn. 54.
23 Martin Kunz, im Interview mit Urs Heinz Aerni, abrufbar bei www.literaturblatt.ch.